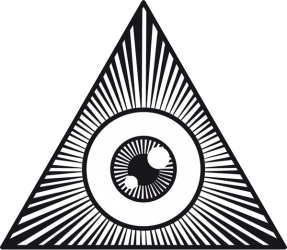Mord und Totschlag, Stasi und Ku-Klux-Clan, Frauen und Drinks – Stefan Maelcks Halle entpupt sich als liebenswerte Loserheimat
Rezension zu „Stefan Maelck: Ost Highway“; Rowohlt Berlin 2003, 219 S.; erschienen in Kreuzer 01/2003
„Lost Songs Found“ heißt die Sendung, mit der Hank Meyer für alle einsamen Seelen den Freitagabend einleitet. Eine Sendung, geschaffen für (oder auch durch) Melancholie und Whisky, weit weg von allem, was der gemeine Hallenser – „Dunkeldeutschland“ galore – normalerweise schätzt. Ganz besonders weit weg von Gerda Lattke, dem Star des mitteldeutschen Blut-&-Boden-„Einserprogramms“. Da Hank Meyer („I’ll be what I am, a solitary man.“) aber nicht nur in Plattenarchiven recherchiert, sondern auch sonst ein echter Detektiv ist, darf er sich bald durch die Vergangenheit, die desaströse Wohnung und die Liebesaffären der ermordeten Spätlüsternen wühlen, durch Stasi-Akten, das Bett ihrer aparten Sekretärin, die Sümpfe von New Orleans, CIA- und Ku-Klux-Clan-Machenschaften obendrein und natürlich durch Unmengen von Whisky und Dixie-Bier.
Eine ost-westdeutsche Detektivgeschichte mit Nick Hornby-Flair hat Stefan Maelck geschrieben. immer mit der richtigen Textzeile irgendeines traurigen Countrysongs an der richtigen Stelle und natürlich immer – oft genug auch auf Biegen und Brechen – mit einem coolen Spruch, man hat schließlich seinen Hammet gelesen.
Vielleicht sollte man wissen, dass Maelck der geborene Protagonist von „Lost Songs Found“ ist – wenn denn hierzulande so etwas denkbar wäre. Statt dessen darf er im richtigen Leben wöchentlich mit den neuesten und ältesten Heavy Metal-Schinken auf Sendung gehen. Eine gespaltene Persönlichkeit irgendwie, deren anderes Alter Ego sich in Klepzig wiederfindet, dem „einzigen Kommissar Deutschlands mit einem Type O Negative-Poster im Büro“.
Ein Panoptikum von skurrilen Gestalten versammelt sich in Ost-Highway, die den Osten mit hämischer Liebe sezieren, sich halb wohlig, halb enttäuscht in ihrem Außenseitersein suhlen und im Zweifelsfall eben tun, was ein Mann tun muss. Da muss man nicht nach Logik fragen, oder nach Wahrscheinlichkeit. Nicht mal die – einigermaßen lapidar geratene – Auflösung des Falles scheint wichtig. Äußerst vergnüglich liest sich das weg, wenn man mit dem Namen Hank Williams etwas anfangen kann, seinen Spaß an einer „Scheißosten“-Talkshow hätte und die „Dir deine Meinung“-Postille immer noch eisern hasst.
Weniger eine ernstzunehmende Story ist das, als ein Manifest allzeit gültigen sympathieheischenden Losertums, manchmal etwas zu dick aufgetragen, aber verdammt nah am Lebensgefühl einer Mittdreißiger-Generation, die sich irgendwie einrichten muss zwischen Halle und Mitteldeutschem Rundfunk, zwischen Resignation und Sturheit, zwischen Lebensnischen und Rentenversicherung. Ein schönes Buch für Zonenerwachsene, die sich nie wirklich ergeben haben.
Augsburg