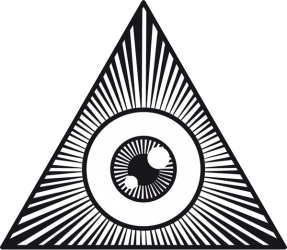„Siggi und der gelbe Hai“ ist das Motto der diesjährigen Jazztage. Die beschäftigen sich mit dem 200. Geburtstag Richard Wagners und dem 20. Todestag Frank Zappas – die Verbindung ist gewollt. Über den Jazzclub im 40. Jahr, die spürbare Erneuerung und Verjüngung der letzten Jahre und natürlich über Geld und „Jazz hat’s“ redet Stefan Heilig, der Geschäftsführer des Jazzclubs und Mitglied des sechsköpfigen Programmbeirats der Jazztage.
Ein Interview mit Stefan Heilig vom Jazzclub Leipzig.
In der Leipziger Volkszeitung.
Frage: Ende September kommen die Jazztage nun auch nochmal mit Wagner. Da wird der normal kulturinteressierte Leipziger vielleicht schon stöhnen.
Stefan Heilig: Ja, vielleicht wird er das. Möglicherweise ist das aber ein guter Zeitpunkt, um sich nochmal mit Wagner zu beschäftigen, weil wir Wagner von einer ganz anderen Seite beleuchten. Für die Hochkultur von Leipzig ist dieser 200. Geburtstag sicher die Chance, Wagner wieder zurückzuholen. Man hatte ja den Ruf der „Wagner-Stadt“ verloren – oder hatte ihn noch nie. Wir wollen zeigen, dass Wagner auch im Jazz funktioniert. Wir beleuchten ihn aber durch die Brille Frank Zappas, also eher parodistisch. Und wer die Jazztage kennt, weiß, dass wir uns immer spannende Themen ausdenken, die auch einen Zeitbezug haben, sprich: die man auch in diesem Jahr machen kann. Wir sind selbst sehr gespannt, wie das funktioniert. Dass es funktioniert, werden wir beweisen. Wir haben tolle Musikerinnen und Musiker eingeladen, die sich speziell mit Wagner beschäftigt haben. Dabei geht es weniger um Pathos als um Leichtigkeit und auch Humor, wie er Zappa zu eigen war.
Es gibt auch dieses Jahr wieder ein Auftragswerk für die Jazztage, diesmal vom Andromeda Mega Express Orchestra, eben mit dieser Wagner-Zappa-Vorgabe. Kauft ihr da die Katze im Sack oder gibt es vorab ein bisschen „Controlling“?
Nein, gibt es nicht. Es ist gerade das Spannende an einem Auftragswerk, wir wissen auch nicht, was dabei rauskommt. Umso sorgfältiger müssen wir natürlich auswählen, müssen wir schauen, zu wem passt es. Man merkt aber recht schnell, ob und bei wem sich eine Leidenschaft entwickelt. Und bisher sind wir eigentlich nie enttäuscht worden. Was dann aber konkret auf der Bühne herauskommt … damit zeigen wir ja, was auch das Spannende am Jazz ist, nämlich das Unerwartete.
Braucht es immer so ein Motto, einen Bezug auf Jubiläen als Klammer für das Festival?
Man braucht es freilich nicht immer. Aber wenn es sich anbietet, warum nicht? Wir arbeiten ja thematisch, im Gegensatz zu vielen Festivals, die einfach einladen, was gerade auf Tour ist. Für uns ist der Zeitbezug immer wichtig: Warum mache ich etwas heute, was nur jetzt funktioniert? Wobei natürlich auch bei uns das Thema nur ein roter Leitfaden ist, es wird ja nicht bei jedem Konzert sklavisch besetzt. Wir schauen aber sehr bewusst, auf welchen Innovatoren unsere musikalische Gegenwart beruht. Das ist kein Zurückschauen, sondern eine Betrachtung, wie sich deren Ansatz ins Heute transportiert hat. Also: Es wird bei den Jazztagen kein Zappa geben, der gecovert wird. Es wird Neues geben, was im Geiste Zappas entsteht. Unerhörtes statt Gebrauchtes.
40 Jahre Jazzclub Leipzig: Ist das für euch ein relevantes Jubiläum?
Es gibt ja gerade in der Kulturbranche die Tendenz, jedwedes Jubiläum zu nehmen und daraus ein großes Event zu machen …
… was ihr schon mal nicht macht.
Wir machen das nicht aber wir wollen den Geburtstag schon feiern und zeigen: Hey, uns gibt es, wir sind 40! Es ist schon ein großes Jubiläum, wir ordnen das aber richtig ein. Ich meine, welcher Verein, noch dazu im Jazz, ist schon 40 Jahre alt? Der Freundeskreis Jazz, so hieß der Jazzclub damals, hat das also auf einem sehr starken Fundament initiiert und bis heute trägt sich dieser Geist fort, erneuert sich natürlich immer wieder unter anderen Rahmenbedingungen. Für uns ist das schon ein Anlass, mal innezuhalten und zu sagen: Wahnsinn, was ist da eigentlich passiert in den 40 Jahren! Es geht uns auch darum, kulturinteressierten Menschen ein wichtiges musikhistorisches Zeugnis der Musikstadt Leipzig zu liefern und die Historie des Vereins und seiner Projekte nachvollziehbar zu machen.
Der Jazzclub hat sich in den letzten Jahren relativ drastisch neu erfunden, man kann das schon an eurem Logo oder den neuen Jazztage-Plakaten erkennen. War das ein schwieriger Prozess, so zwischen – sagen wir mal – Traditionalismus und Jugend?
Ich würde nicht sagen, dass es ein übertrieben schwieriger Prozess war. Natürlich gibt es immer bei Entwicklung und Veränderung ein Für und Wider. Wir sind ein Verein, der sich aus sehr vielen Gedanken und Ideen speist. Aber seit ich hier bin, haben wir uns immer gemeinsam mit dem Vorstand und vielen Mitgliedern zusammen überlegt, welche Faktoren wir finden, welche entscheidenden Dinge wir erfinden und neu entwickeln müssen. Uns war völlig klar, dass es für die Zukunft nicht genügen würde, ein elitäres Jazzfestival zu haben, das mit dem Publikum immer älter wird. Wir haben dann relativ schnell entschieden, dass wir uns programmatisch breiter aufstellen müssen, dass wir auch über die Jazztage hinaus wieder zu einer Konzertpraxis kommen müssen. Wir waren schon mit unseren wöchentlichen Konzerten im Telegraph plötzlich wieder über das ganze Jahr sichtbar.
Das entspricht sehr der Gründungstradition des Jazzclubs. Die Jazztage waren anfänglich im Konzertjahr ja eher eine Art Kulminationspunkt der Jahresarbeit, nicht deren ausschließliches Ziel.
Genau. Es gab in den Siebzigern und Achtzigern sehr viele Konzerte und auch Vorträge. Später fokussierte sich alles auf die Jazztage, weil die natürlich auch plötzlich riesig groß geworden waren. Das ist ja auch eine Kapazitätsfrage. Aber über diese „Neuerfindung“, gerade den neuen visuellen Auftritt, haben wir lange nachgedacht, die war sicher für uns eine gewaltige Zäsur. Schon weil die eigentlich zeitlosen Grafiken von Jürgen Haufe (1999 verstorbener Grafiker und Typograf aus Dresden; d. A.) den Verein sehr, sehr lange geprägt haben. Es gab auch urheberrechtliche Schwierigkeiten, wir konnten das nicht mehr uneingeschränkt so verwenden, wie wir das hätten tun müssen. Man sieht jedoch auch, dass der Verein durch diesen frischen Auftritt wieder mehr in den Fokus gerät. Das reicht bis zu unserer rasant steigenden Mitgliederzahl. Allein in den letzten anderthalb Jahren sind 70 neue Mitglieder eingetreten, wir sind jetzt bei knapp 200. Und was mir persönlich ganz wichtig ist: Der Ton des Jazzclubs hat sich geändert, die Ansprache, die Texte in den Broschüren. Es ist nicht mehr alles so bierernst, so musikwissenschaftlich. Es ist jetzt mehr sinnlich, auch lustig – aber gleichsam mit Tiefe.
Der uralte „Jazz hat’s!“-Slogan hat es aber überlebt.
(lacht) Ja, hat er. Das ist ein Spruch, der vor allem den älteren Jazzclub-Mitgliedern noch sehr vertraut sein wird. Ich finde ihn auch zeitlos und immer noch so frisch, dass wir nicht darauf verzichten wollen. Und: Der Spruch stimmt einfach.
Die Verjüngung im Jazzclub-Büro ist unübersehbar, die Mitgliederzahlen steigen wieder. Ist das eine Entwicklung, die sich auch beim Publikum nachhaltig niederschlägt?
Es ist für uns spürbar. Wir haben das Festival deutlich vergrößert, früher waren es vier Tage, heute sind es zehn. Wir haben neben der Oper dabei so viele neue Spielorte – UT Connewitz, Schaubühne Lindenfels, Galerie KUB, Conne Island, Michaeliskirche –, die ziehen auch in ihrem Stadtteil neues Publikum an; ohne die „Eintrittshürde“ Oper. Wir sind in die Szene reingegangen, haben genau geschaut, wie wir neue Entwicklungen, wie wir neue Entwicklungen im Jazz – besonders in Verbindung mit Clubkultur – präsentieren können. Und wir merken zunehmend, wie man uns als Veranstalter auch traut, dass es gut ist, was wir dort machen. Wir waren in den so genannten Nebenspielstätten jetzt fast immer ausverkauft. Das kann man nicht nur mit unserer Werbung und unserem neuen visuellen Auftritt erklären. Am Ende geht es ja doch um das Programm, darum, was auf der Bühne passiert.
Es gibt seit zwei, drei Jahren eine recht heftige Diskussion um den „Jazzstandort“ Deutschland. Grundtenor ist „Der Szene geht’s schlecht, man kann nicht mehr von Jazz leben, die Infrastruktur bricht zusammen.“ Reicht das Thema bis in den Jazzclub hinein?
Freilich diskutieren wir diese Dinge immer mit, denken sie immer mit. Prinzipiell hat es aber wahrscheinlich zu keiner Zeit eine einfache Situation für Jazz gegeben. Insofern glaube ich nicht, dass es uns heute ganz besonders schlecht geht. Natürlich schließt bedauerlicherweise immer mal ein Club. Aber es gibt auch immer wieder Neugründungen und die Szene ist sehr aktiv. Man muss aber auch sehen, dass jährlich hunderte Absolventen die Musikhochschulen verlassen; top ausgebildete Leute. Nie war die Qualität der Musiker in Europa so hoch wie jetzt. Das bedeutet aber nicht, dass in gleichem Maße Auftrittsmöglichkeiten hinzukommen. Es ist inzwischen zu viel Angebot für einen zu kleinen Markt. Man muss da auch als Veranstalter sehen, wie man damit umgeht: Man lädt Leuchttürme ein, man lädt aber auch Newcomer ein, die einen neuen Ausdruck provozieren. Man braucht die Bereitschaft zum Risiko. Ohne die gibt es auch keinen Erfolg.
Wie geht es den Jazztagen, dem Jazzclub finanziell?
Schwierige Frage, die darf man ja weder so noch so beantworten. Wir haben einerseits zwei Premium-Sponsoren, die Köstritzer Schwarzbierbrauerei und die BMW-Niederlassung, die sich dankenswerterweise seit Jahren bei uns engagieren. Andererseits gehören wir zu den Vereinen, die mit im Moment 130.000 Euro doch recht ordentlich von der Stadt gefördert werden. Wir sind da in einem guten Kontakt, genießen Vertrauen, was man schon an unserem Rahmenvertrag sieht, der ja für die Verwaltung keine einfache Angelegenheit ist. Wir sind uns aber bewusst, dass das etwas Besonderes, ein Privileg ist. Welche Wertschätzung das Festival insgesamt erfährt, zeigt sich aber nicht nur in der städtischen Förderung. Wir bekommen 30.000 Euro von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, mehr bekommt kein Jazz-Veranstalter in Sachsen. Da sind wir nochmal beim Thema „Braucht man ein Motto?“ Die öffentlichen Förderer merken wohl auch, da macht sich jemand einen Kopf, arbeitet konzeptionell. Man muss auch sehen, dass sich der Veranstaltungsmarkt in den letzten Jahren sehr professionalisiert hat. Das fängt mit der zum Teil rect schwierigen Vertragsgestaltung an, reicht bis zum Umgang mit den vielen Tarifen der GEMA, Leistungsschutzrecht, Ausländersteuer und Künstlersozialkasse. Das ist ein zum Teil sehr anspruchsvolles Aufgabenfeld, das sich nicht mehr ohne Weiteres ehrenamtlich machen lässt, weil man dafür Expertise braucht, also Personal. Das ist, woran es uns so ein bisschen fehlt. Ich bin der einzige Festangestellte, insgesamt sind wir mit allen Praktikanten und den Ehrenamtlichen aus dem Verein eine relativ überschaubare Truppe. Wir bräuchten also eigentlich eine zweite Stelle.
Die Jazztage hatten im letzten Jahr 6.000 Besucher. Viel mehr geht eigentlich nicht bei diesem Festival-Umfang.
Wir waren sehr gut ausgelastet, sowieso in den Clubs, aber auch in der Oper. Drei Tage Konzert im Opernhaus ist schon ein Mammutprogram, man muss da für die dementsprechende Dramaturgie sorgen. Wir sind wirklich guter Dinge, die Besucherzahlen waren jetzt Jahr für Jahr ansteigend. Aber es gibt kein Wachstums-Dogma. Wenn wir das Niveau vom letzten Jahr halten könnten, wären wir glücklich und zufrieden.
Es hat sich in den letzten Jahren eine Art musikalische Klammer der Jazztage herausgebildet, die neben klassischem Jazz stark elektronische und Neue Musik einbezieht. Ist das die „Nische“ für euch in der Festivallandschaft, eine Art Alleinstellungsmerkmal?
Jjjein. Es gibt einige Festivals, die über den Tellerrand schauen. Die Schnittstellen zwischen Neuer Musik und Jazz sind ja heutzutage fließend. Jedes Festival positioniert sich, versucht, eine gewisse Klammer zu finden. Für uns ist das eindeutig – und das war eine sehr bewusste Entscheidung – der zeitgenössische Jazz, auch immer wieder eigene Projekte zu initiieren. Ob das dann mit Electronica oder Neuer Musik angereichert ist, ob es traditionellere Elemente enthält oder aus dem Freejazz kommt, ist eigentlich egal. Für uns ist wichtig, am Puls der Zeit zu sein und immer dafür zu sorgen, dass das Festival nicht nur ein Schaukasten ist, sondern immer auch ein Stück Werkstatt. Ich würde es auch eher „Profil“ nennen, als „Nische“.
Ein Profil, das sich aber nach einem gewissen programmatischen Stillstand zum Ende der Ära Bert Noglik – bis 2007 langjähriger Kopf des Jazzclubs – neu herauskristallisiert hat.
Ich glaube nicht, dass es bei Bert Stillstand gab. Er hatte sein Konzept, mit dem jeweiligen Fokus auf eine bestimmte Region oder ein bestimmtes Land, bestimmte Musiker und hat damit den Jazztagen zu einem internationalen Renommee verholfen. Er hat sich dabei tolle Projekte auch jenseits des Tourkalenders ausgedacht und im Grunde führen wir diese Idee fort. Wir haben sie natürlich mit neuen Sachen angereichert. Jazz entwickelt sich, das Publikum entwickelt sich. Das ist heute viel wissender und anspruchsvoller und wir müssen viel mehr neue Impulse zulassen. Aber eins scheint mir wichtig zu sein, und das hat Bert schon damals gesehen: Es ist dieser besondere Hunger nach Gegenwart, den es in Leipzig gibt. Und den wir versuchen, mit dem Jazzfestival zu befriedigen.
Die Zusammenarbeit mit dem MDR scheint ungebrochen schwierig.
Hier muss man unterscheiden. Was die Situation der Vergütung von Senderechten oder Lizenzen anbelangt, ist die Situation nicht ganz einfach. Noch vor vier Jahren war der MDR mit Lizenzrechten für Sendungen ordentlich engagiert. Heute ist das auf eher symbolische Beiträge zurückgefahren, Senderechte werden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Grunde gar nicht mehr vergütet. Es gibt insgesamt zu wenig Sendeplätze für den Jazz und zudem eine Konkurrenzsituation der verschiedenen Veranstalter – der MDR muss ja drei Länder gleichermaßen bedienen.
Mir fällt gerade kein vergleichbares mitteldeutsches Jazzfestival ein, vom Programm und der Größenordnung her.
Das ist, was wir dem MDR auch immer versuchen zu sagen. Dass wir dort einen besonderen Bonus hätten, was Tradition, Innovation, Konzept angeht, spüren wir eher nicht. Häufig begegnet man uns auch mit dem Argument, vieles sei nicht mehr sendbar. Selbst das Sophie Hunger Konzert im vergangenen Jahr wurde zunächst als unsendbar eingeschätzt. Da waren wir kurz sprachlos. Erst als der WDR mit im Boot war gab es dann sogar eine Liveübertragung. Redaktionell ist das Festival bei Figaro aber sehr gut aufgehoben, es gibt Interviews, Festivalbeiträge und Festivaltrailer, die Figaro rund um das Festival sendet. Über die Kulturpartnerschaft sind wir sehr dankbar. Es gibt aber generell nur noch wenig Programmfläche für zeitgenössischen Jazz. Wir im Verein und viele Zuhörer bedauern das. Und es stellt sich mir auch die Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht auch dafür da ist. Wenn nicht er, wer dann? Wenn wir uns zum 40. was wünschen dürften, dann, dass es mehr Sendeplätze für zeitgenössische und improvisierte Musik gibt. Es geht dabei ja auch gar nicht um uns. Wir wollen, dass die Musikerinnen und Musiker sichtbarer, hörbarer werden. Und die Szene hier ist so spannend, sie verdient es einfach, dort abgebildet zu werden.